Berufsfeld: Vorstand einer Produzentengalerie
|
Interview |
|
|
Wie sind Sie zum Kunstverein gekommen? Hatten Sie zuvor Kontakt zu Kunstvereinen und welche Vorstellung hatten Sie davon? |
Wie funktioniert die Vernetzung in Ihrer Institution? Hat das einen regionalen oder lokalen Bezug, da Sie nur aus dem Umkreis Mitglieder haben oder sind Sie mit anderen Mitgliedern innerhalb Deutschlands auch im Austausch?
Das Künstlerhaus ist dieser Ort, unsere Galerie. Der Verband an sich heißt Berufsverband bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK), der bundesweit organisiert ist. Es gibt auch verschiedene Bezirksgruppen mit insgesamt 56 Bezirken. Jedes Bundesland hat einen Landesverband und darunter gliedern sich die Bezirksverbände. In Baden-Württemberg gibt es Bezirksverbände in Ulm, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim und Südbaden. Man kann sich freilich auch woanders um eine Mitgliedschaft bewerben, aber als Vorstand möchte man die Leute schon dazu anregen, möglichst im eigenen Umfeld Mitglied zu werden, weil dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie sich auch effektiv engagieren und in den Verband einbringen.
Auf welche Weisen bietet der BBK Künstler*innen Unterstützung?
Der BBK versteht sich als Interessenvertretung – ähnlich einer Gewerkschaft für Künstlerinnen und Künstler – und arbeitet tatsächlich auch seit den 1950er Jahren daran, bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen für Künstler*innen zu erreichen. Die Künstlersozialkasse (KSK) geht beispielsweise auch auf ganz starkes Betreiben des BBKs zurück. Die KSK ist eine Unterstützungsmöglichkeit für Künstler*innen, die selbstständig oder teilselbständig sind und normalerweise sehr hohe Abgaben an Krankenkassen zahlen müssten, die sie sich aber mit dem künstlerischen Einkommen einfach nicht leisten können. Dies hängt wiederum damit zusammen, dass es in Deutschland immer noch keine Verpflichtung gibt, Künstler*innen Honorar zu bezahlen. Es sind extrem hochwertig und hoch professionell ausgebildete Menschen und trotzdem gelingt es den Kommunen und dem Land nicht, Strukturen zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, davon ein angemessenes Leben zu bestreiten. Das Modell der KSK sieht vor, dass die Hälfte der Beiträge übernommen werden, indem beispielsweise Galeriebetreiber*innen dazu verpflichtet werden, eine Abgabe von 4,2% in die KSK einzuzahlen. Das ist ähnlich zur GEMA, wenn man in einem Restaurant sein Radio anschaltet, muss man auch Gebühren bezahlen und das gleiche gibt es nun in der bildenden Kunst auch.
Es klingt durch, dass bei Ihrer Position im Künstlerhaus ein politisches Interesse erforderlich ist, um die Interessen der Kunstschaffenden an denjenigen Stellen zu vertreten, die Regularien verabschieden. Ist es so, dass man in Ihrer Position automatisch viel mit den Kommunalpolitiker*innen spricht oder würden Sie sagen, dass Sie sich das selbst auf die Fahne geschrieben haben?
Der Vorstand des BBK setzt sich aus zwei Vorsitzenden sowie acht weiteren Mitgliedern zusammen. Die Vorsitzenden nehmen eine besondere Rolle ein. Jede*r Vorsitzende muss selbst für sich auslegen, was die Rolle für ihn oder sie bedeutet. Es ist tatsächlich mein großes Interesse, mich als Vorsitzende sehr engagiert einzusetzen. Wenn der BBK eine Berufsvertretung ist, dann muss der Vorstand auch genau das erfüllen. Für mich ist diese Stelle sehr wichtig, da es nicht viele Positionen gibt, in denen man für so viele Künstler*innen sprechen kann und die zugleich auch ein Gewicht haben, sodass man etwas Druck ausüben kann. Nach drei Jahren Erfahrungen in dieser ehrenamtlichen Position bin ich überhaupt nicht politikverdrossen, denn man kann sehr viel verändern, wenn man sehr viel dafür arbeitet und vor allem über Aufklärung Verständnis generiert. Dies ist praktisch Lobbyarbeit, so wird Politik gemacht. Man gibt Presseartikel heraus, beschreitet viele Kommunikationswege, versucht strategisch vorzugehen und vermittelt immer wieder: Wie stellt sich die Arbeitssituation Bildender Künstler*innen dar? Wie ist der Status quo? Was bewirkt Kunst für die Gesellschaft? Was braucht es dafür und was möchte man eigentlich erreichen?
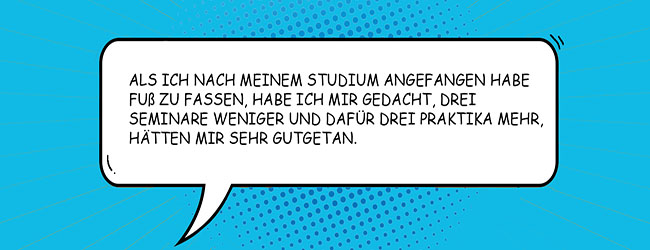
Wie sieht Ihr Alltag aus und welche besonderen Aufgaben kommen auf Sie zu?
Das Reden gehört tatsächlich zentral zu dieser Tätigkeit. Man organisiert sehr viel und muss in Besprechungen, öffentlichen Gesprächen oder auf Konferenzen sehr viel Kommunikation betreiben. Als Vorsitzende des Künstlerhauses sind wir auch Teil der Jury für die Künstlermesse in Karlsruhe. Dann gibt es die Jahreskarte und andere Flyer, deren Gestaltung und Druck wir veranlassen. In Corona-Zeiten versuchen wir die neuen Möglichkeiten zu nutzen, um über Instagram-Postings, online Diskussionen oder Eröffnungen die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken.
Gibt es einen Themenschwerpunkt, der Sie besonders in Ihrer Arbeit interessiert oder den Sie gerne kuratieren würden?
Ich versuche die Vorstellungen von Normalität, von der Bedeutung der Geschichtsbeschreibung und die Kanonisierung in der Kunstgeschichte zu hinterfragen. Ein Bewusstsein für die Relevanz der Chronologie unserer Kunstgeschichte als Geschichte männlicher, weißer Genies kommt mir mehr und mehr abhanden. Ich merke in meiner Praxis, dass die Dinge alle stark vernetzt sind. Es gibt keine Narration und kein Narrativ, das sich nicht durch ein anderes Narrativ überschreiben lassen könnte. Diese Hinterfragung geschieht nicht um der Kritik wegen, sondern weil aus meiner Sicht sehr viele Korrekturen notwendig sind und es eine ständige Arbeit an dem braucht, was der Mainstream vermittelt. Mit dem Postkolonialismus beispielsweise kommt es zu einer überfälligen Überarbeitung unserer Archive, unserer Kunstgeschichtsschreibung und damit auch unseres Kulturverständnisses.
Wenn das Künstlerhaus primär für Praktiker*innen angelegt ist, können wir als angehende Kunsthistoriker*innen trotzdem in Ihrem Kontext tätig werden? Gibt es Bereiche, in denen unsere Expertise fruchtbar gemacht werden kann?
Ja, unbedingt! Kunsthistoriker*innen können für unsere Ausstellungskataloge auch Texte schreiben. Wir freuen uns auch sehr, wenn wir in Zukunft mit dem KIT oder der Pädagogischen Hochschule enger in Kontakt treten, um diese Verbindung zur Theorie auch lebendig zu machen. Ich glaube, dass die Kunst das auch braucht. Wir bieten zu unseren Ausstellungen auch gerne ein Vermittlungsprogramm an, indem wir einerseits Kunstwissenschaftler*innen einladen, zu Ausstellungseröffnungen einen kurzen Vortrag zu halten. Diese Präsentation könnte eine bestimmte Thematik der Arbeiten erläutern, Zusammenhänge auf den Punkt bringen oder aber periphere Aspekte bzw. Kontexte hervorheben. Sie würden dies selber recherchieren, z.B. indem Sie auch Gelegenheit haben, mit den Künstler*innen sprechen. Sie bilden sozusagen die Schnittstelle zwischen den Künstler*innen und den Betrachter*innen oder versuchen diese Lücke zu schließen. Ohne eine solche Brücke geht es selbst in Museen nicht, wo wir über ein wenig Erklärung in den Saaltexten dankbar sind. Ich finde, dass diese Vorstellung, dass man in Museen geht, völlig allein und versunken vor den Werken steht und die Kunst im White Cube auf sich wirken lässt, einer bestimmten Zeit entsprungen ist. Ich habe den Eindruck, dass sich eine Entwicklung anbahnt, die davon abweicht und sich verschiebt weg von sehr konzeptuellen Herangehensweisen hin zu Arbeitsweisen, die das Publikum wirklich abholen und eine Art von Dialog herstellen. Letztendlich geht es schon darum Kommunikation aufzubauen. Es ist für mich persönlich eine unangenehme Haltung, wenn Künstler*innen implizit das Gefühl vermittelt wird, sie sollten besser nicht über ihre Arbeit sprechen, weil das den Zauber nimmt oder man davon ausgeht, dass die Betrachter*innen alles selbst erkennen müssten.
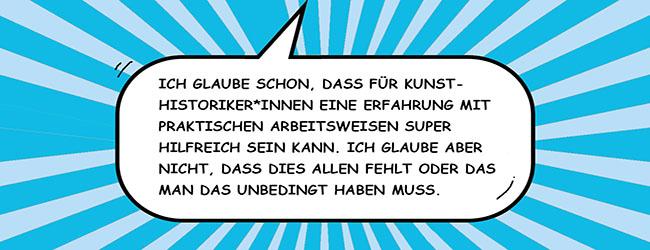
Was sollten Studierende idealerweise mitbringen und was möglichst nicht, um im Künstlerhaus einen Praktikumsplatz zu bekommen? Gibt es Voraussetzungen, die die Chancen erhöhen?
Wenn ich merke, dass jemand wirklich neugierig ist sowie ein ganz großes Interesse und eine Offenheit hat, dann sind die Chancen sehr gut, um bei uns aufgenommen zu werden. Es ist uns wichtig, dass man gerne auf Menschen zugeht, mit ihnen arbeitet und spricht und das gerne auch mit einer Portion Humor verbindet. Es kann natürlich sehr anstrengend sein, aber dafür erhalten Sie einen tiefen Einblick, nicht zuletzt in die hiesige Kulturpolitik und generell in das kulturelle Leben von Karlsruhe. Allerdings ist ein große Hürde für vor allem ehrenamtlich geführte Orte, dass die Zeit fehlt, um Praktikant*innen gut zu betreuen. Es ist wirklich entscheidend, dass die Kommune auch die Bildende Kunst so gut ausstattet wie die Theater, und auch in der Freien Szene die Möglichkeit erkennt, zahlreiche Arbeitsplätze zu schaffen.
Das Interview wurde am 18. Januar 2021 geführt und von Inge Hinterwaldner bearbeitet.
Beate Fricke |
Ulrich Schneider |
Kirsten Voigt |

