Biografie Beate Fricke
|
Prof. Dr. Beate Fricke (geb. 1974) schloss 1999 ihr Magisterstudium im Fach Kunstgeschichte an der Universität Karlsruhe ab. Ihre Dissertation “Götzendienst und Bildkultur. Die Statue der Hl. Fide von Conques” wurde 2004 an der Universität Trier ausgezeichnet. Im Anschluss war sie bis 2008 an der Universität von Zürich als Wissenschaftliche Assistentin angestellt. Von 2009-2016 lehrte sie – zuletzt als Full Professor – Kunstgeschichte des europäischen Mittelalters an der UC Berkeley. Währenddessen erhielt sie am Zentrum »Geschichte des Wissens« (ZGW) der Universität Zürich mehrfach ein SNF Postdoctoral Fellowship. Zudem unterrichtete Frau Fricke 2010 und 2012 als Gastprofessorin an der ECNU in Shanghai und an der LMU München. Seit 2017 arbeitet Frau Fricke als Professorin für Ältere Kunstgeschichte an der Universität in Bern. Neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit im Bereich mittelalterliche Kunst, ist sie seit 2010 als verantwortliche Redakteurin an der Herausgabe verschiedener Zeitschriften engagiert, wie etwa der Zeitschrift ‘21:Inquiries into Art, History, and the Visual’. Darüber hinaus setzt sie sich für den freien und vereinfachten Zugang zu online veröffentlichten Publikationen ein, unter anderem als SNF Open Access Ambassador. |
Berufsfeld: Hochschullehre/ProfessorIn
|
Interview |
|
|
Im Portal Kunstgeschichte steht zu lesen: „Der Aufstieg an Universitäten ist abhängig von akademischen Titeln, einer geradlinigen kunsthistorischen Karriere, Behauptungswillen und einem langen Atem. Eine Prise Glück gehört angesichts der großen Konkurrenz auch dazu“ [link]. Würden Sie diesem Zitat zustimmen? |
 |
Wenn man karrieretechnisch die Welt bereist, ist es so, dass man sich in den unterschiedlichen Hierarchien der Hochschulsysteme manchmal anpassen oder sich und seine eigene Position unterordnen muss? Wie schafft man es, sich in diese Hierarchien gut einzufinden und produktiv zu sein, ohne sich zu unterwerfen?
Interessant ist, dass die Hierarchien während des Aufstiegs ganz unterschiedlich ausgebildet sein können, je nachdem in welchem akademischen System man sich bewegt. Ich habe drei Mal die akademischen Systeme gewechselt. Ich war in Deutschland, der Schweiz und in den USA und die Systeme sind alle unterschiedlich. In den USA beispielsweise, haben meine KollegInnen und ich viel voneinander gelernt. Um an einer Universität zu unterrichten, ist Teamarbeit unbedingt notwendig. Dabei lernt man voneinander, wie man versuchen kann, langsam Systeme von innen heraus immer wieder zu verändern und zu reflektieren. Glücklicherweise habe ich an der Universität Bern ebenfalls KollegInnen, die genau das wollen. Ich hätte vermutlich Schwierigkeiten damit, wenn ich an einem Institut arbeiten würde, an dem es kein Interesse an einem Austausch untereinander und der Weiterentwicklung der Systeme gäbe. Der Wechsel zwischen verschiedenen Systemen ist meiner Meinung nach produktiv, wenn man überlegt, was man von dem einen System in das andere übernehmen kann, ohne es jedoch fundamental zu verändern.
Gab es jemanden, der Sie besonders geprägt oder auf Ihrem Weg unterstützt hat?
Das ist eine unendlich lange Liste! Dazu gehören FreundInnen und KollegInnen, mit denen ich Gedanken ausgetauscht habe. Das ist vielleicht die Art von Förderung, die in keinem CV auftaucht, aber für mich die Wichtigste darstellt, weil sie die Begeisterung am Leben hält und woraus sich immer wieder neue Projekte und Ideen entwickeln. Darüber hinaus gibt es die üblichen akademischen FördererInnen, wie etwa die Doktormutter oder in meinem Fall den Doktorvater. Im US-amerikanischen System braucht man verstärkt Unterstützung in Form von Empfehlungsschreiben, aber ebenso von Personen, die sich in jeder Stufe der Beurteilungen immer für einen einsetzen. Eine Karriere ist nie das Werk eines Einzelnen. Man schaut auf eine Person, die Teil eines riesigen Netzwerks ist, zu dem jedeR Einzelne etwas beigetragen hat.
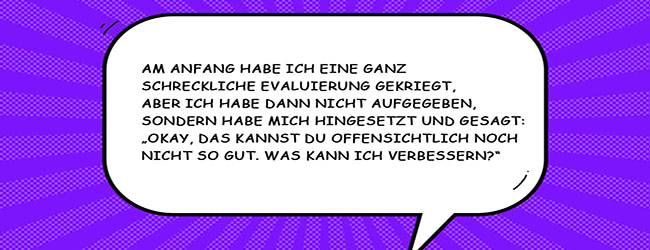
Gab es einen ausschlaggebenden Moment, der Sie für den Beruf der Professorin begeistert hat und in Ihnen den Wunsch geweckt hat, diesen Weg zu gehen?
Man kann sich das nicht so einfach wünschen und dann diesen Weg einschlagen. Es gibt nur sehr wenige freie Stellen, weshalb man immer ganz realistisch sein und das schlimmste Szenario durchgehen muss: Was passiert, wenn es nicht klappt? Man sollte unbedingt einen Plan B im Hinterkopf haben. Als Studentin in Karlsruhe dachte ich das erste Mal darüber nach, dass das ein interessanter Beruf für mich sein könnte. Ich hatte Praktika in Museen gemacht und ganz schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Zeitgleich gab es eine Initiative von den Geisteswissenschaften der Universität Karlsruhe, das mich an die Hochschullehre herangeführt hat. Im Rahmen eines Pilotprojekts für die Einführung des Bachelor- und Masterstudiums wurden vier StudentInnen – ich war eine davon – befragt, wie sie sich die ideale Lehre vorstellen. Dafür durften wir zusammen ein Seminar nach unseren Ideen entwickeln und durchführen. Damals hatte ich zum ersten Mal gemerkt, wie viel Spaß das Unterrichten machen kann. Aber noch während der Dissertation sagte ich mir: Wenn ich nach dem Abschluss nicht mindestens zwei Angebote bekomme, aus denen ich auswählen kann, dann höre ich auf und mache etwas anderes.
Wie frei ist man als Professorin bei der Themenauswahl der Seminare, die man anbietet? Ist man durch gewisse Anforderungen oder Vorgaben des jeweiligen Instituts eingeschränkt?
Das hängt von Ihrer eigenen Kreativität ab. Man muss schauen, wie man die Regeln mit dem verbindet, was man machen möchte. Ich habe beispielsweise schon ein Seminar zur mittelalterlichen Kunst Afghanistans in europäischen Museen gegeben, das in Kopenhagen und Paris stattfand, und zwar in Zusammenarbeit mit einer Spezialistin für die Kunst Afghanistans. Für mich ist es ein wichtiges Anliegen, dass ich durch externe Expertise Studierenden spezifische und häufig auch außereuropäische Bereiche eröffne, die ich selber inhaltlich gar nicht abdecken kann. Leider gibt es diese nicht-westlichen Perspektiven in Europa kaum oder gar nicht, obwohl in unseren europäischen Sammlungen häufig eben solche Objekte und Kulturen vertreten sind. Dafür werden aber gar keine Leute ausgebildet und das finde ich ein erhebliches und zu adressierendes Problem. Das kann ich zum Teil dadurch verändern, dass ich ExpertInnen einlade, die dann mit mir zusammen unterrichten oder indem wir Forschungsreisen zu speziellen Themen durchführen und die Studierenden für eben diese Themen begeistern können.
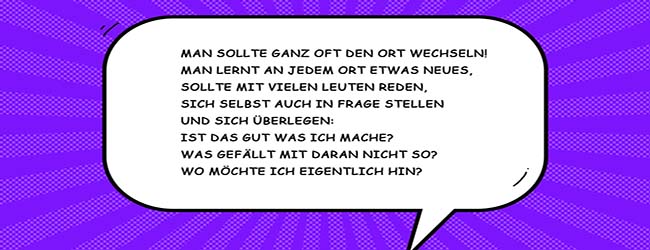
Wie sehen die einzelnen Schritte von der Ideenfindung bis zur Durchführung eines Forschungsprojektes aus? Wie leicht kann man eine solche Idee umsetzen? Das braucht sicherlich finanzielle Mittel, Personal und Zeit...
Ich habe das Glück, dass ich durch eine Stiftung, die an meinen Lehrstuhl gebunden ist, unterstützt werde. Das bedeutet, dass ich sofort etwas umsetzen kann, wenn ich eine Idee habe. Dadurch bin ich in der Auswahl meiner Projekte relativ unabhängig. Bei vielen meiner Ideen entstehen zunächst keine Kosten. Dies geschieht nur, wenn ich Projekte mit anderen zusammen angehen oder etwas publizieren möchte. Dafür muss man dann Gelder beantragen, was wiederum ein bisschen Zeit braucht. Das größere Hindernis besteht darin, dass man an zu vielen Aufgaben gleichzeitig arbeitet und sich selbst täuscht, indem man sich vornimmt: 'Wenn ich das alles erledigt habe, dann kann ich endlich mein Forschungsprojekt angehen.' Wenn man dann aber an diesem Punkt angelangt ist, hat man plötzlich keine Lust mehr oder findet die Idee inzwischen unsinnig beziehungsweise unplausibel. Diese Entstehungsprozesse nehmen etwas mehr Zeit in Anspruch. Wenn man aber größere Projekte mit anderen im Verbund aufsetzen möchte, ist das noch zeitintensiver. Einen wirklich guten Antrag für ein großes Projekt zu schreiben, dauert drei Monate, aber die hat man im seltensten Fall am Stück. Dafür muss man sich immer wieder zwischendrin Zeit nehmen, bis der Antrag dann endlich steht.
Haben Sie einen geregelten Tagesablauf? Welche Aufgaben gehören zu Ihrem Alltag und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht man verstärkt in Ihrem Beruf?
Ich habe dann einen geregelten Arbeitsalltag, wenn ich ihn selber plane. Je nachdem, ob ich kurz-, mittel- oder langfristige Termine und Projekte habe, gibt es Unterschiede bei der Planbarkeit des Alltags. Neben gutem (Zeit-)Management und Organisationstalent, muss man mit einem Budget haushalten können. Das ist vor allem wichtig, wenn man eine größere Reise plant. Zu meinem Alltag gehört ebenfalls das Schreiben. Ich habe beispielsweise gerade ein Buch abgeschlossen, woran ich über einen Zeitraum von 13 Jahren gearbeitet habe. Solche Prozesse laufen bei uns die ganze Zeit während des Alltags. Darüber hinaus nimmt der E-Mail-Verkehr sehr viel Zeit in Anspruch. An der University of California in Berkeley habe ich täglich ‒ quasi im Minutentakt ‒ bis zu 300 E-Mails bekommen. Allerdings bestimmt man selber darüber, wann man erreichbar ist. Man muss schauen, dass man sich Freiräume für das Forschen schafft und dass das Administrative oder die Vorbereitung und Durchführung der Unterrichtszeit nicht überhandnimmt. Ich versuche außerdem, Forschung und Lehre zu verbinden, um so Synergieeffekte zu erzeugen. Mit meinen StudentInnen zusammen zu arbeiten, ist oft eine wirkliche Inspiration für mich und dadurch haben meine Unterrichtsthemen häufig mit meiner Forschung zu tun. Allerdings ist das, was man unter einem geregelten Arbeitsalltag versteht, glaube ich ziemlich passé. Normalerweise reisen wir sehr viel, schauen Ausstellungen an oder haben Sitzungen und Tagungen an unterschiedlichen Orten. Für Personen, die geregelte Arbeitsabläufe und -zeiten brauchen, ist der Job dementsprechend schwierig.
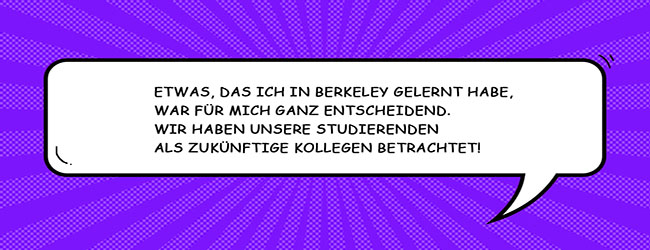
Sie haben für viele Schritte in Ihrer akademischen Laufbahn den Wirkungsort gewechselt. Ist das etwas, was Ihnen ans Herz gelegt wurde? Dadurch erhält man ja auch eine Art sichtbare Anerkennung, ein 'Siegel', durch andere Universitäten und nicht nur durch eine einzige Institution.
Es ist nicht unbedingt ein 'Siegel', das Sie bekommen würden. Jedoch verschließen Sie sich sehr vielen Möglichkeiten, wenn Sie alle Ausbildungsschritte an nur einem Ort absolvieren. Ganz viele Netzwerke eröffnen sich einem nicht, wenn man immer nur am selben Ort verbleibt. Wenn ich beispielsweise Bewerbungen lese, in denen steht: Bachelor Berlin, Master Berlin, Doktorarbeit Berlin, dann ist das nicht unbedingt eine Auszeichnung. Bei jedem Schritt sollte man sich genau überlegen, was man in dieser Phase gerne machen möchte und was die geeignetste Institution dafür ist. Das ist im seltensten Fall immer dort, wo Sie sich schon befinden. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass sich Ihre Interessen mit der Expertise vor Ort decken. Die meisten Personen mit erfolgreichen Karrieren wechseln spätestens ab der Dissertation bei jedem weiteren Schritt ihre Institution. Vielen von Ihnen macht das wahrscheinlich Angst, weil Sie das Gefühl haben, dass Sie die ganze Zeit umziehen müssen, Ihr gewohntes Umfeld und Ihre Freunde verlieren. Aber Sie wissen gar nicht, wie viel Sie durch so einen Wechsel gewinnen. Nur durch diese Horizonterweiterungen bekommen Sie so viele neue Ideen, die Ihnen sonst verwehrt bleiben. Deshalb ist das unglaublich wichtig!
Welche Tipps würden Sie uns geben, die uns den Einstieg ins Berufsleben erleichtern könnten?
Lernen Sie so viele Sprachen so früh wie möglich! Ich habe im Alter von 40 Jahren versucht Arabisch zu lernen ‒ das war nicht einfach. Sie sollten ins Ausland gehen und die verschiedenen akademischen Kulturen kennenlernen. Rückblickend würde ich mehr Tagungen besuchen und mir mehr über Themen anhören, die mich interessieren. Schauen Sie, wie Symposien generell funktionieren, denn davon kann man schon einiges ableiten, was sich auf den wissenschaftlichen Betrieb übertragen lässt. Ansonsten sollte man nicht unterschätzen, dass man im Leben immer einen interessanten Dialog aufbauen kann, wenn man einfach neugierig ist und die Zusammenarbeit mit anderen nicht als Konfrontation begreift, sondern als intellektuelles Vergnügen!
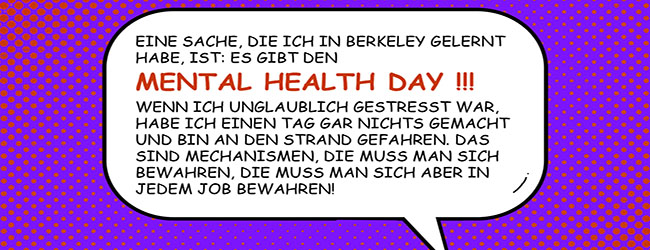
Das Interview wurde am 23. November 2020 geführt und von Saskia Baude bearbeitet.
Lisa Bergmann |
Ulrich Schneider |
Kirsten Voigt |

