Dr. Kirsten Claudia VoigtKuratorin und Konservatorin für Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe |
 |
Biografie Kirsten Claudia Voigt
|
Berufsfeld: KuratorIn und KonservatorIn
|
Aufgaben der Kuratorin
Aufgaben der Konservatorin
|
Interview |
|
|
Das Tätigkeitsfeld von Kurator*innen ist breit aufgestellt. Sie betreuen Museumssammlungen, organisieren Ausstellungen, arbeiten an Ausstellungskatalogen und betreiben Öffentlichkeitsarbeit. Und alles steht unter einem streng einzuhaltenden Budget- und Zeitplan. Welche fachlichen und sonstigen Fähigkeiten muss man mitbringen, um den Kurator*innenberuf erfolgreich ausüben zu können? Zunächst muss man die ganz große Zuneigung zur Sache, zum Stoff an sich mitbringen. Man muss wirklich Freude an der Kunst haben. Aber man muss auch Ideen haben. Wenn man zum Beispiel Ausstellungen aus dem Museumsbestand heraus organisiert, ist es wichtig, sich vorher intensiv in diesen eingearbeitet zu haben. Nur so kann man Ausstellungskonzepte entwickeln. Meine Fragestellungen in diesem Prozess sind: Was wollen wir aussagen? Wie sehen wir die Geschichte der Bilder innerhalb unserer Gegenwart? Wie können wir mit einem neuen Blick sowohl an das herangehen, was in der Sammlung gezeigt wird, als auch an das, was im Depot lagert? Aus dieser Vertrautheit mit dem eigenen Bestand lassen sich auch Ideen für die Konzeption von großen Ausstellungen mit Leihgaben entwickeln. Als Fähigkeit finde ich es gut, wenn man auch praktisch veranlagt ist. Es ist nicht sehr hilfreich, wenn man nur an der Theorie interessiert ist. Man sollte sich schon auch dafür interessieren, Forschungsergebnisse und Erkenntnisse praktisch zu vermitteln – auf unterschiedlichste Weise, mit vielen Methoden und Medien, im Dialog mit anderen Disziplinen und Menschen. Es ist also nicht verkehrt, wenn man sich um vieles Verschiedene kümmern kann und möchte. |
Welche dieser Fähigkeiten haben Sie im Studium erlernt und welche an anderer Stelle, z.B. in Ihrer früheren Tätigkeit als Journalistin, entwickelt?
Im Studium habe ich mit Sicherheit nicht alles gelernt, was ich jetzt brauche. Da sind Sie jetzt in einer viel besseren Situation. Zum Beispiel gab es den akademischen Bereich und Übungen vor Originalen, aber keine Praxisübungen. Das, was wir gemeinsam in den Übungen erarbeiten [Anmerkung: Frau Voigt ist seit 1999 Lehrbeauftragte am Institut Kunst- und Baugeschichte des KIT], also zum Beispiel Texte für die Homepage der Kunsthalle zu erstellen und Vermittlung zu üben, gab es damals nicht. Was das Praktische betrifft, ist natürlich jede*r anders veranlagt. Ich glaube aber, dass ich durch meine journalistische Praxis eine ganze Menge Pragmatismus mitgebracht habe. Wenn Sie Zeitungsartikel produzieren und sich täglich der öffentlichen Kritik stellen müssen, dann ist das eine gute Schule. So habe ich gelernt, mit Zeitdruck umzugehen, zu funktionieren, abzuliefern. Als ich dann ins Museum ging – zunächst als Pressesprecherin – habe ich mir vorgestellt, dass alles gemächlicher zugeht. Das war ein großer Irrtum! Da ist heutzutage deutliche Präsenz gefordert, auch von Kurator*innen und Konservator*innen. Wissenschaftler*innen, die sich hinter den Kulissen auf die Forschung konzentrieren, sind nicht mehr gefragt. Sie müssen vermitteln, sich mit Budgetfragen auseinandersetzen, und und und…
Sie beschreiben, dass Sie von Ihrer journalistischen Tätigkeit sehr viel mitgenommen haben. Würden Sie Studierenden empfehlen, sich einen Nebenjob zu suchen, der genau in diese Richtung geht?
Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist: schreiben lernen und lesen, lesen, lesen. Das ist ganz wichtig und auch einer meiner Hauptzugänge gewesen. Ich erinnere mich, dass mein Interesse an der Kunstgeschichte mit Kindlers Malerei-Lexikon anfing, das ich als Kind bei meinen Eltern im Bücherregal gefunden habe. Ich habe oft darin gelesen, die Bilder gesehen und mich gefragt, was sie bedeuten. Warum macht Picasso das? Was ist Kubismus? Mein früher Impuls war, vermitteln zu wollen, zu versprachlichen, auch kritisch, was ich an Motiven und Zusammenhängen erahne. In meinem Studium an der Universität Fridericiana [Anmerkung: Vorgängerin des KIT] in Karlsruhe war es eine wichtige Erfahrung, dass unser damaliger Ordinarius Johannes Langner großen Wert auf eine sehr hohe sprachliche Präzision im Umgang mit der Betrachtung und Beschreibung der Werke gelegt hat. Wenn Sie also Ihre sprachlichen Fähigkeiten parallel zum Studium erweitern und üben können, zum Beispiel durch freie Mitarbeit bei einer Zeitung, dann ist das sicherlich günstiger für Sie als kellnern zu gehen.
Wie sieht Ihr beruflicher Alltag aus?
Ich bin sehr stark projektorientiert im Team unterwegs. Jede*r von uns hat fast jeden Tag irgendeine Art von Sitzung, was zuweilen anstrengend, aber völlig unumgehbar ist. Ein konkretes Beispiel: Wenn ich eine Idee für eine Ausstellung habe, muss ich diese zunächst in der sogenannten Wissenschaftler*innen-Sitzung vorstellen. Es wird lange darüber diskutiert, ich sammle Material, es vergehen viele Wochen oder Monate und die Idee wird zum Konzept. Irgendwann kommt vielleicht das „Go“ für die Ausstellung. Daraufhin wird entschieden, ob sie als Ein-Personen-Projekt oder von mehreren Kolleg*innen und Volontär*innen gemeinsam erarbeitet wird. Eine große Landesausstellung kann niemand mehr allein machen. Es folgt eine weit verzweigte Zusammenarbeit mit allen Teams im Haus, also den Registrar*innen, den Restaurator*innen, den Ausstellungsarchitekt*innen, den Fotograf*innen, die die Bilder für den Katalog produzieren, und der Haustechnik, aber auch die Kooperation mit Externen – anderen Kunsthistoriker*innen, Leihgeber*innen, Ausstellungesarchitekt*innen, Sammler*innen und vor allem natürlich Künstler*innen ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit.

Wie gehen Sie konkret an die Konzeption einer neuen Ausstellung heran?
Die Idee für die Ausstellung Inventing Nature (2021) hatte ich zum Beispiel schon seit sehr vielen Jahren. Seitdem war ich auf der Suche nach Künstler*innen, die sich mit Natur beschäftigen oder beschäftigt haben. Ich habe auch auf Reisen immer wieder danach Ausschau gehalten, was in die Ausstellung passen könnte, wodurch ein ganzer Pool zusammenkam. Dann musste ich überlegen, wie die Werke aufeinander bezogen und den Raumverhältnissen der Kunsthalle angepasst werden konnten.
Die Ausstellung über Silvia Bächli im Jahr 2019 war lange ein Traum von mir. Bächli war Professorin an der Kunstakademie in Karlsruhe und macht eine sehr reduzierte, auf manche Besucher*in vermutlich eher spröde wirkende Art von Kunst. Sie ist eine coole „White Cube-Frau“, die großzügig und Bauhaus-artig streng denkt. Aufgrund eines Umbaus in der Kunsthalle konnten wir ein passendes Raumkonzept für die Ausstellung erstellen. Dann ging der Prozess mit der Künstlerin los, ein freudiges Ringen miteinander, welche Arbeiten gezeigt werden.
Ich liebe es generell, mit interessanten lebenden Künstler*innen zu arbeiten, das sind starke Persönlichkeiten. Bei Atelierbesuchen oder im direkten Austausch mit Künstler*innen lernt man als Kunsthistoriker*in enorm viel. In den 80er- und 90er-Jahren habe ich den Austausch mit Künstler*innen vor allem in Künstlergesprächen und Interviews bei Atelierbesuchen, aber auch im Rahmen von Ausstellungen gesucht und bin damals zum Beispiel John Chamberlain, Alex Katz, Hamish Fulton, Wolfgang Laib, Anselm Kiefer, Tony Cragg, Jürgen Klauke, Sigmar Polke, Gotthard Graubner, Camill Leberer, Timm Ulrichs, Raffael Rheinsberg, Rainer Ruthenbeck, Rolf-Gunter Dienst, Rune Mields oder Liz Bachhuber begegnet, um nur einige wenige zu nennen. Es ist sehr interessant, wie diese Künstler*innen Kunstgeschichte anders sehen als wir, da sie vom Produzieren her denken.
Wo sehen Sie für Studierende in Ihren Lehrveranstaltungen den größten Mehrwert, in die praktische Arbeit eingebunden zu werden?
Sie können an fast jeder Stelle eingebunden werden und der Mehrwert liegt natürlich im Erwerb von ersten Eindrücken und Erfahrungen. Im Rahmen der Vorbereitung der Ausstellung Inventing Nature haben wir uns zum Beispiel in drei aufeinanderfolgenden Semestern mit dem Natur-Thema befasst. Wir tasteten uns zunächst an das kunsthistorische Material heran, indem wir Natur- und Pflanzendarstellungen in der Kunsthalle betrachteten. Dabei wählte ich solche Arbeiten aus, die Schlüsselmomente innerhalb der Ausstellung darstellen. Daraufhin schrieben die Studierenden Texte für den Mediaguide. Auch das Verfassen von Katalogtexten könnte man wunderbar üben. Wir haben uns anschließend damit auseinandergesetzt, wie man die Ausstellung interessant vermitteln könnte, zum Beispiel auf der Homepage der Kunsthalle und in einem Begleitheft für Kinder und Jugendliche zur Ausstellung. Dieser studentische Input wurde dann auch tatsächlich auf der Homepage publiziert und führte zur Herausgabe einer eigenen ausstellungsbegleitenden Publikation. Es wäre auch spannend, die Studierenden in den Aufbau der Ausstellung zu involvieren, also in die Überlegungen, was wo wie gehängt oder installiert wird. Den Moment, den man leider nicht begleiten kann, ist der, an dem die Kurier*innen mit den Werken kommen. Es wird sehr streng gehandhabt, wer zum Zeitpunkt der Übergabe mit im Raum sein darf.
Worauf achten Sie bei Studierenden? Habe ich es als Studierende selbst in der Hand, herauszuragen?
Ich achte darauf, welche Fähigkeiten vorhanden sind. Wie kann jemand beobachten? Hat jemand die ausreichende Hingabe, sich wirklich ernsthaft und tief mit etwas auseinanderzusetzen? Vielleicht hat jemand auch Freude daran, das, was erkannt wurde, zu vermitteln? Natürlich muss Engagement und Leistungsbereitschaft vorhanden sein. Und es ist ideal, wenn jemand eine schnelle Auffassungsgabe hat. Soft Skills spielen eine Rolle. Für mich persönlich ist es auch wichtig, dass Studierende nicht nur Kosten-Nutzen-Rechnungen aufmachen, im Sinne von „ich mache jetzt nur genau dies genau dafür“. Es bleiben mir Studierende im Gedächtnis, bei denen ich merke, dass sie von selbst für die Beschäftigung mit der Kunst brennen, die Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Das braucht man im Museum. Wenn man eine Idee für eine Ausstellung hat, dann kämpft man dafür, das ist kein Selbstläufer. Und mitunter sind diverse Hürden zu überwinden, bis man ein Projekt verwirklichen kann.
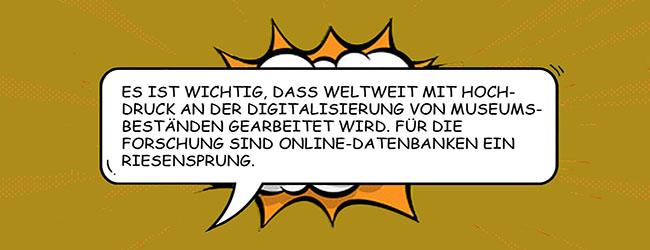
Wie erreiche ich das Ziel, Kurator*in zu werden, am besten?
Wenn ich das wüsste…(lacht). Auf jeden Fall muss man sehr gut studieren und sehr intensiv Möglichkeiten der Weiterbildung nachgehen. Um den eigenen Horizont zu erweitern, empfehle ich auch, zwischendurch woanders zu studieren. Ganz viele von Ihnen sind außerordentlich rege, da bin ich immer wieder voller Bewunderung. Wesentlich finde ich auch, dass man sich ein spezifisches Forschungsfeld sucht, sich möglichst tief und fachlich seriös in etwas hineinbegibt. Das ist einfach ein Pfund, wenn man sich selbst etwas erarbeitet, was von Belang ist. Ich bin ehrlich gesagt keine Vernetzungsapologetin. Ich würde versuchen, das inhaltlich anzugehen.
Der klassische Weg zum Kurator oder zur Kuratorin in großen Häusern und auch bei uns in der Kunsthalle geht meist immer noch über die Promotion. Diese benötigen Sie in der Regel für Volontariate, die das Sprungbrett für die Kunsthistoriker*innen-Stellen sind. Aktuell verändert sich das ein bisschen dahingehend, dass auch Nicht-Promovierte als Volontär*innen zum Beispiel bei uns in der Kunsthalle eingestellt werden können. Aber natürlich sind auch Leute wie Udo Kittelmann ein wunderbares Gegenbeispiel. Sie können eine*r der bekanntesten deutschen Kurator*innen werden und keine Promotion haben. Aber dann sollten Sie sich einen Off-Space und Künstler*innen suchen und spannende Ideen generieren. Je nachdem, welches Segment Sie ansteuern, kann das genauso gut und vielleicht sogar besser klappen als der klassische Weg.
Sie empfehlen, im Laufe des Studiums die Uni zu wechseln. Sie selbst sind jedoch bis zur Promotion in Karlsruhe geblieben. Gab es dafür einen bestimmten Grund?
Wenn ich ehrlich bin, wollte ich immer weg. Aber ich finanzierte mein Studium durch meine Tätigkeit bei verschiedenen Zeitungen und dann bot man mir eine feste Redakteurinnenstelle an. Ich haderte lange und rang mit mir, ob ich diese annehmen soll, und entschied mich dafür. Das ist zweischneidig. Einerseits möchte man eine feste Stelle, um sich eine Existenz aufzubauen, andererseits war es mir wichtig zu promovieren. Ich habe meine Promotion dann während meiner Zeit als Redakteurin gemacht, weil ich diesen Traum nicht aufgeben wollte.
Neben Ihrer Tätigkeit als Kuratorin sind Sie auch Konservatorin. Was grenzt diesen Beruf von dem des Restaurators/der Restauratorin ab?
Restaurator*innen gehen technisch mit dem Material des Werkes um, arbeiten handwerklich mit Pinsel und Skalpell, mit Lösungsmitteln, Firnis und mit dem Röntgengerät. Das dürfte ich nie machen, das wäre eine heillose Katastrophe (lacht). Konservator*innen sind Kunsthistoriker*innen, die eine Abteilung verwalten und sich darum kümmern, dass deren Bestand richtig konserviert, also verwahrt, ausgebaut, erforscht und vermittelt wird. In Abgrenzung dazu konzipieren Kurator*innen Ausstellungen.
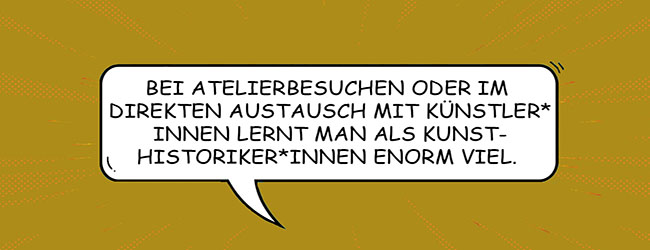
Wie sind Sie zu Ihren Forschungsschwerpunkten gekommen?
Das hat sehr persönliche Gründe. In den 80er-Jahren faszinierte mich Beuys schon als Schülerin unheimlich. Ich hatte das Gefühl, ihn zu verstehen. Ich finde auch, dass jeder Mensch kreatives Potenzial hat, dass es eine gestaltende Handlung ist, wenn wir uns miteinander unterhalten, wenn ich ein Kind erziehe oder ich meinen Garten bestelle. Diese Idee der Sozialen Plastik war mir sehr nahe. Mich faszinierte auch Beuys‘ Ästhetik immer total. Also Kunst, die ich nicht nur mit den Augen, sondern als ganzer Mensch wahrnehme, und die mich auffordert, mitzuarbeiten. Ich möchte nicht etwas Fertiges vorgesetzt bekommen, sondern möchte mich hineinbegeben können, mich durch die Wahrnehmung verändern. Ich erinnere mich an einen Moment, an dem mir im Kunstmuseum Basel bei Beuys‘ Feuerstätte fast die Tränen kamen, weil sie die Utopie einer friedlichen Gemeinschaft von Individuen darstellt. Aber ich muss auch sagen, dass ich in der langen Zeit, in der ich in der Kunsthalle arbeite, wirklich alle Werke dort gleich intensiv lieben gelernt habe. Das Museum wird von 2022 bis vermutlich 2027 saniert und deshalb geschlossen sein. Wenn ich jetzt Rundgänge durch das Haus mache, habe ich ein bisschen Angst vor dem Moment, an dem ich mir die Werke nicht mehr regelmäßig in diesen alten, auf ihre Weise eindrucksvollen Räumen anschauen kann.
Welche Chancen sehen Sie in der aktuellen Corona-Situation in digitalen Vermittlungsstrategien? Gibt es aus Ihrer Sicht auch Nachteile?
Ich finde digitale Vermittlungsstrategien sind ein fabelhaftes Hilfsmittel. Mit ihnen können wir im Moment Vieles gut kompensieren. Man kann durch die Schlüssellochperspektive auf Kunstwerke und in Ausstellungen schauen und sich informieren, was Appetit auf mehr macht. Aber für mich ist klar, dass dadurch kein Museumsbesuch ersetzt werden kann. Ich will das Werk in seiner ganzen Dimension im Raum sehen, den Kontext zu den anderen Bildern haben. Ich finde es auch schwierig, wenn das Internet zu einer Boulevardisierung von Wissensvermittlung beiträgt und dadurch die tiefere Auseinandersetzung mit einem Thema wegfällt. Wenn es darauf hinausläuft, dass wir nur noch 120 Wörter über jedes Bild schreiben, finde ich das einfach nicht angemessen und wertschätzend. Aber es ist wunderbar und nicht nur für Forscher*innen hilfreich, dass weltweit mit Hochdruck an der Digitalisierung von Museumsbeständen gearbeitet wird. Für die Forschung sind Online-Datenbanken ein großer Sprung nach vorne.
Vielen Dank für dieses Gespräch!
Das Interview wurde am 7. Dezember 2020 geführt und von Dora Tanswell bearbeitet.
Lisa Bergmann |
Beate Fricke |
Ulrich Schneider |
